| Zeitschrift Umělec 2011/1 >> Krieg ohne Frontlinie | Übersicht aller Ausgaben | ||||||||||||
|
|||||||||||||
Krieg ohne FrontlinieZeitschrift Umělec 2011/101.01.2011 Ilya Plekhanov | in transition | en cs de ru |
|||||||||||||
|
Ilja Plechanov ist Gründer und Chefredakteur des Almanachs Die Kunst des Krieges. Mit seiner Hilfe konnte die Ausgabe 1/2009 von Umelec realisiert werden. Er ist Absolvent der Fakultät für Wirtschaft und Informationssysteme der Universität Neusüdwales (Sydney). Später spezialisierte er sich in Japanologie und Geschichte am Institut für Asien- und Afrikawissenschaften. Von 1991-1995 nahm er an den Kriegen im ehemaligen Jugoslawien teil. Die literarische Tätigkeit Plechanovs beschränkt sich nicht nur auf den Almanach und Publikationen zu sicherheitspolitischen Themen, sondern umfasst auch Gedichte und Übersetzungen aus dem Englischen, Japanischen und Serbischen, die bereits in verschiedenen Sammelbänden veröffentlicht wurden. Plechanov ist Ehrenbürger der nordirakischen Stadt al‑Amādiyya.
Nachfolgend stellen wir zwei von Plechanov speziell für Umelec geschriebene Texte vor. Der erste handelt von den jüngsten Ereignissen in Kirgistan, wo der Autor während des Höhepunktes des ethnischen Konfliktes einige Tage zubrachte, der zweite von weiter zurückliegenden Geschehnissen im Irak. Ethnische Konflikte ohne Frontlinie sind besonders schwierig. Obwohl, eigentlich gibt es eine Frontlinie – du bist sie. Es ist sinnlos, irgendwo nach einer Spur, nach einem Fixpunkt im Gelände zu suchen. Es genügt, in den Spiegel zu schauen oder sich seine Gesichtszüge vorzustellen. Um dich herum sind Tausende ebensolcher Menschen, jeder betrachtet dich argwöhnisch, fragt sich, wer du sein magst. Und du erwiderst den Blick, versuchst herauszufinden, ob man dich gleich töten wird oder nicht. Und gleichzeitig entscheidest du, was du im nächsten Augenblick sein wirst: Mörder, Schlächter, Fliehender, Retter, Mensch oder Bestie. Die endlose Kette von Situationen, in denen du nicht mit dem Verstand, sondern nach Gefühl entscheidest, in denen du alles, was Gott, die Familie und die Gesellschaft dir gegeben haben, auf den Prüfstand stellst, entzweit die Menschen, zerrüttet ihre moralische Festigkeit, treibt sie an die äußersten Grenzen und über diese Linie hinaus. Dann zeigt sich ihr innerstes Wesen. In einem ethnischen Konflikt bist du völlig allein, mehr als je zuvor oder danach, mehr als je ein Soldat oder Bürger eines Staates. Es gibt keine gesellschaftlichen Institutionen mehr, die dir Zuflucht gewähren könnten. Es gibt nur deine Abstammung (Blut) und dein gegenwärtiges Gesicht. Noch hast du deine Wahl nicht getroffen. Später werden sie dich jagen, oder töten, oder es gelingt dir zu überleben. Du musst nur entscheiden, wie du dich hier und jetzt, an deiner eigenen Front des ethnischen Konflikts verhalten wirst. Dieser Konflikt war keine Ausnahme. Viele sagten in diesem Krieg, dass sie viele neue Seiten ihrer Mitmenschen entdeckt hätten, dass sie keine Ahnung gehabt hätten, wie jemand wirklich ist, wie viele politische Eliten, Nachbarn, Schreihälse und unscheinbare Schweigende es gibt und wie viel sie selbst wert seien. Anstand und Niedertracht. Einige haben es sogar geschafft, zwischen diesen beiden Eigenschaften hin und her zu wechseln. In diesem Krieg haben sich die Menschen bewusst entschieden. Wir haben es gesehen. 15.06.2010. Bischkek: brennende Häuser, Barrikaden, Flüchtlinge, Banditen Das erste, was dem Neuankömmling am internationalen Flughafen Manas auffällt, ist die Zahl amerikanischer Flugzeuge auf dem Rollfeld. Kampfflugzeuge der US Air Force. Mehr als die Hälfte. Alle in trübem, schmutzigem Grün. Ihr Anblick versetzt einen augenblicklich in ernste Stimmung. Das morgendliche Bischkek wirkt leer, Menschen und Autos sind praktisch nicht zu sehen. Die Berggipfel leuchten in erhabener Schönheit über der Stadt. Man möchte weder über den Krieg noch über das Morden nachdenken. Doch schon die ersten Gespräche mit den Einwohnern und der Anblick niedergebrannter Häuser holen einen in die menschliche Wirklichkeit zurück. Eine der Brandruinen ist das ehemalige Haus von Bakijew. Jetzt wohnen Invaliden darin, bewachen es vor den Marodeuren. In den Straßen stößt man bald hier, bald dort auf geplünderte Läden und Kaffeehäuser. Wir fahren am Haus von Bakijews junger Frau vorbei. Nach örtlichen Maßstäben gleicht es einem Palast. Der Fahrer fährt uns an der weißrussischen Botschaft vorbei. Als „Väterchen“ Lukaschenko dem gestürzten Präsidenten Aufnahme gewährte, musste die Botschaft schleunigst evakuiert und die Türen zugenagelt werden. An der Umzäunung des Regierungsgebäudes sind die Spuren der Kämpfe deutlich sichtbar. Passanten betasten die Löcher, welche die Kugeln hinterlassen haben, fotografieren sie mit ihren Handys, schweigen. Einschusslöcher sind von beiden Seiten zu sehen, aber aus dem Regierungsgebäude heraus wurde deutlich mehr geschossen. An der Zahl der Löcher im Eisen lässt sich erahnen, wie heftig der Schusswechsel gewesen sein muss. Einige Abschnitte der Umzäunung sind verbrannt. Trümmerteile werden aus dem Regierungsgebäude herausgetragen, Wände verputzt, neue Fenster eingesetzt. Ein Stockwerk ist fast vollständig zerstört. In Bischkek spricht man von 2000 getöteten Usbeken und Leichenbergen in den Straßen. Alle warten auf die Eskalation der Gewalt. In Nachrichten aus Osch ist die Rede von niedergebrannten Häusern und Kaffees, von abgehackten Händen. Die Stadt ist zur Hälfte abgebrannt, es gibt kein fließend Wasser mehr. Die umliegenden Dörfer sind vollkommen abgeriegelt, niemand wird mehr hereingelassen. Über Bakijews Familie wird viel gesprochen. Nur schlechtes. So lange Bakijew an der Macht war, fuhren die Drogenbosse offen durch die Stadt und amüsierten sich. Unter seiner Herrschaft wurde Privateigentum zu Gunsten der „Familie“ konfisziert. All dies erinnert stark an den Irak. Saddam Husseins Diktatur und der Anschein von Ruhe und Stabilität, bevor das Land, nach dem Sturz des Regimes und dem Verschwinden des Diktators, in einem Strudel von Chaos und Gewalt versank. Erstaunlicherweise gibt es in Bischkek keinen Zwist zwischen den Ethnien, nirgendwo habe ich ein Wort des Hasses gegenüber irgendeiner Nationalität vernommen. Angeklagt werden nur Bakijews Provokateure. Sowohl die Stadt als auch das Land warten auf Hilfe. Wenn noch ein Monat vergeht, ohne dass etwas unternommen wird, sagen die Einheimischen, dann ereilt Bischkek dasselbe Los wie Osch. Und Politiker warnen davor, dass ganz Kirgisien sich innerhalb eines Monats in eine riesige Todeszone verwandeln könnte. Je länger der Konflikt dauert, desto stärker treten destruktive Kräfte, einschließlich radikaler Islamisten, zu Tage. Zuviel Blut wird täglich vergossen. Es wird immer schwieriger, das Geschehen zu vergessen. 18.06.2010. Osch: Die Usbeken haben nichts mehr zu verlieren. Alles, was ich in Bischkek geschrieben habe, scheint mir hier, in Osch, wie ein böser Traum. Ich war schon an vielen Kriegsschauplätzen, aber was ich hier gesehen habe, lässt sich mit nichts vergleichen. Die Waffen des 21. Jahrhunderts sind nicht Flugzeuge und Bomben, sondern mit Nägeln und Bajonetten gespickte Keulen schwingende Männer. Die usbekischen Viertel sind nicht nur zerstört, sondern förmlich pulverisiert worden. Kein Stein ist auf dem anderen geblieben. Es wurde ohne Ausnahme alles niedergebrannt, Schulen, Krankenhäuser, Wohnhäuser, sogar eine Moschee. Diese Bilder sind schrecklich anzusehen. Ein einziger Vergleich schießt mir durch den Kopf: Hiroshima! Heute sieht die Situation folgendermaßen aus. Die Usbeken sitzen in ihren verbarrikadierten Stadtvierteln, welche sie unter keinen Umständen verlassen. Das Volk ist wie benommen, Hass staut sich an, Wunden werden geleckt, Journalisten zu den Orten der Gräuel geführt, Tote beerdigt. Im Stadtzentrum sind nur Kirgisen unterwegs, nichts hat geöffnet, von der Staatsmacht keine Spur, von Zeit zu Zeit wird geschossen. Viele Zivilisten sind bewaffnet. Es gibt auch viele Uniformierte, und ständig treffen weitere Kirgisen aus allen Landesteilen ein, was Anlass zu der Befürchtung gibt, dass das Schlimmste noch bevorsteht. Zwar gibt es Wasser und Strom, aber das ist alles. Der „Kontrollpunkt“ ist ein unter dem Grenzzaun hindurch gegrabenes Loch. Auf der anderen Seite stehen zwei finstere usbekische Soldaten. Nur Schwerverletzte werden angenommen. Die anderen Flüchtlinge, ungefähr 1500 Personen, leben an der Grenze. Es gibt weder ausreichend Nahrungsmittel noch Medikamente. Die Menschen stehen unter schrecklicher Anspannung. Im Grenzgebiet gibt es niemanden, keine internationalen Organisationen, überhaupt nichts. Das Hauptproblem sind die „Geiseln“, genauer gesagt, Menschen, die sich in den Wohngebieten der feindlichen Ethnie befinden. Man muss den Journalisten Respekt aussprechen, die mit Hilfe ihrer Ausweise diesen Usbeken helfen, unter den Blicken der Massen die kirgisischen Stadtviertel zu verlassen. Damit üben sie eine Funktion aus, die nicht ihrer eigentlichen Abeit entspricht. Sie retten Frauen und Kinder, die fünf, sechs Tage ohne Essen in ihren Wohnungen ausgeharrt und mit dem Schlimmsten gerechnet hatten. Es gibt ungefähr 300 bis 400 solcher Geiseln. Sie muss man wirklich retten, sonst verhungern sie oder werden getötet. In den usbekischen Vierteln sind immer noch die Überreste verbrannter Menschen zu sehen. Mit Beginn der Sperrstunde, gegen 6 Uhr abends, wird es wirklich gefährlich. Eine seltsame, bewaffnete Menge schlendert durch die Straßen, nicht selten sind Betrunkene mit Kalaschnikows darunter, pausenlos sind Schüsse zu hören. So begann mein Geburtstag in den ersten Morgenstunden des 17. Juni auf einer Parkbank, in Gesellschaft eines müden, Bier trinkenden kirgisischen Soldaten. Im Verlaufe unseres Gesprächs geriet er immer mehr in Rage, zupfte am Schloss seines Maschinengewehrs und entsicherte es. Er war sehr erstaunt, als ich ihn geradeheraus fragte, wieso er so etwas während eines Gesprächs tue. Ein anderes Problem sind die Straßensperren. Auf ihnen stehen lokale Freischärler, hasserfüllte vermummte Jugendliche. Sie richten ihre Gewehrläufe auf Passanten und führen sich flegelhaft auf. Usbeken werden festgenommen und weggefahren – wohin, weiß man nicht. Menschen verschwinden. Wer keine Papiere hat, wird sofort festgenommen und weggeschafft. Über Erschießungen ist bisher nichts bekannt. Insgesamt stehen die Menschen ob der Geschehnisse noch unter Schock. Niemand weiß, was tun. Die Usbeken sitzen in ihren Ghettos, auf kirgisischer Seite kommen immer mehr Menschen hinzu, man bewaffnet sich. Nicht nur die Dimensionen der Barrikaden sind beeindruckend, auch die Zahl der von Kugeln und Granaten hinterlassenen Einschusslöcher. Über der Stadt kreisen Hubschrauber, Flugblätter werden abgeworfen, auf denen die Bevölkerung zur Ruhe aufgerufen wird. Vor den Helikoptern verstecken sich die Menschen im Schatten der Mauern, aus Angst, es könnte auch daraus geschossen werden. In der Stadt herrscht totale Anarchie, aber Armee und Polizei versuchen, die Lage in den Griff zu bekommen. Ich habe das Gefühl, dass es bald von neuem losgeht. Es gibt immer mehr Bewaffnete, und mit jedem Tag werden sie nervöser und hasserfüllter. Alle bitten Russland um Hilfe, flehen um russische Truppen, damit die Usbeken eine Chance haben zu fliehen, Lebensmittel zu kaufen, ihr Leben zu retten. In Wirklichkeit geht es zu wie in einem Albtraum. Als ich am Markt vorbeifahre, erwischt mich beinah eine Kugel. Zwei Stunden später höre ich, wie im kirgisischen Staatsfernsehen verkündet wird, die Lage in Osch normalisiere sich und die Menschen spazierten friedlich durch die Straßen. Das ist vollkommener Unsinn, alles Lüge. Es gibt nur wenig Menschen, ein Geruch von Rauch und Ruß hängt über der Stadt, und früher oder später werden die Usbeken versuchen, die Barrikaden um ihre Wohngebiete zu durchbrechen oder zu zerstören. Zu verlieren haben die Usbeken nichts. 22.06.2010: Osch in der Gewalt der Angst: Zusammenfassung der letzten Tage Nachts in einem verbarrikadierten usbekischen Viertel, einem Machalla, erzählt ein Zahnarzt, während sich draußen der Gesang des Muezzins erhebt, dass Zahnschmerzen und der Beruf des Zahnarztes jenseits von Politik und Nationalität lägen. So kämen miteinander verfeindete Führer unterschiedlicher Lager zu ihm in ein und dieselbe Praxis, um sich behandeln zu lassen. Wie ganz normale Menschen. Wir lauschen. Ein paar schlaflose Stunden vergehen vor unserem Abflug in den Süden Kirgisiens. Plötzlich klingelt mein Handy. In der Stille höre ich die Stimme einer jungen Moskauerin. Sie sagt, dass unserem Reisebegleiter für die Umgebung von Osch der Kopf abgeschnitten worden sei. Ich gebe den Hörer an Arkadij weiter, meinen Kollegen, mit dem ich hergereist bin. Arkadij hört sich die Einzelheiten an. Ein unangenehmer Schauer läuft mir über den Rücken. Mir fällt auf, dass am Himmel, obschon wolkenlos, keine Sterne zu sehen sind. Später wird man den Tod unseres Begleiters, eines Beamten des Innenministeriums und seines Fahrers, bestätigen. In Bischkek müssen wir Schmiergeld zahlen, um nach Osch zu fliegen. Auf dem Landweg zu reisen war unmöglich. Die Konvois waren schon weg, und ein Teil der Kolonne nach Dschalalabat war wegen des wiederholten Beschusses der Straße gestrichen worden. Am Flughafen machen sie uns bis zwanzig Minuten vor dem Abflug eine Szene: keine Flugtickets mehr, unsere Reservierung verkauft … Und das, obwohl leere Ticketvordrucke direkt vor unserer Nase liegen. Unsere humanitäre Hilfe (zwei Pack Wasser in dünnen Zellophantüten), die Fleischkonserven und die Zigaretten werden nicht als Handgepäck zugelassen, obschon die unkluge Fracht im Frachtraum auslaufen könnte. Auch unser Hinweis „Das ist doch für ihr Volk bestimmt!“ bleibt ohne Wirkung. Eine junge Russin, die auch nach Osch zu ihren Verwandten möchte, wird gezwungen, für Übergepäck zu bezahlen, obwohl wir uns einverstanden erklären, es über uns einzuchecken. Die junge Frau wehrt sich lautstark und bricht beinahe in Tränen aus. Die Zollbeamten bleiben unerbittlich. Unsere Laune verschlechtert sich zusehends. Wir treffen den Flughafenkommandaten von Bischkek, Vissarion Alekseevič Kim. Ich halte es für notwendig, Vissarion Alekseevič auf Grund seiner Leistung zur Auszeichnung vorzuschlagen. In dem Chaos der Evakuierung, inmitten hin und her rennender Menschen, finsterer, mit Schrotflinten und Maschinengewehren bewaffneter Gestalten, die sich an den Waschbecken der öffentlichen Toiletten waschen, verbitterter und verzweifelter Flüchtlinge, gibt er klar und scharf einen Befehl nach dem anderen und weist seine Leute ruhig und selbstbewusst an. Er schafft es sogar noch, uns in einer freien Minute sein Telefon zu geben und blitzschnell die Fragen der sich um ihn herum angesammelten Menge zu beantworten. Vor meinen Augen organisiert er die Ausgabe von kostbarem Brot und Wasser an turkmenische Studenten, die schon tagelang auf dem Flughafen festsaßen. Bislang gab es keine turkmenische Maschine für sie, obschon im selben Zeitraum die Türkei ihre Bürger evakuiert hatte, ein chinesisches Flugzeug da gewesen war, und Frauen und Kinder an Bord eines Flugzeugs des russischen Ministeriums für Katastrophenschutz ausgeflogen worden waren. Die Anordnungen des Flughafenkommandanten werden von zwei, drei Mann der Flughafenwache widerspruchslos ausgeführt. Es kommen neue Busse mit Flüchtlingen an. Ich schaue in die Augen des Kommandanten und sehe, dass er todmüde ist, wahrscheinlich mehrere Tage nicht geschlafen hat, höre, wie er sich heiser geschrien hat, sehe aber auch, dass er seine Arbeit erledigt, dass er in seinem Element ist, dass seine Abteilung arbeitet und Menschen ungeachtet ihrer Nationalität rettet. Auch eine auf seinen Befehl zusammengestellte Gruppe für die Entladung von humanitären Hilfsgütern arbeitet. Einen Flugkapitän bittet Vissarion Alekseevič, noch mehr Frauen und Kinder an Bord zu nehmen. Dieser entschuldigt sich, er habe bereits Überlast und so zu fliegen sei gefährlich. Auf Anordnung des Kommandanten werden in den vergangenen und nachfolgenden Tagen auch erschöpfte und entnervte russische Journalisten ausgeflogen. Nur dank ihm können Arkadij und ich auf wundersame Weise an Bord einer Diplomatenmaschine der Vereinten Nationen Bischkek verlassen. Beim Verlassen des Flugzeugs fragen wir einen Vertreter der UNO, was diese zu unternehmen gedenke. „Nichts“, antwortet dieser vollkommen ruhig. „Die Kirgisische Regierung hat uns offiziell kein einziges Mal um Hilfe ersucht.“ Wir warten auf einen Wagen des Polizeichefs der Region Osch, Omurbek Suvanaliev, der uns abholen soll. Während wir warten, beobachte ich die herumlungernden und auf Armeelastwagen herumsitzenden Soldaten und Freischärler. Während die Soldaten auf den Lastwagen aussehen wie eine Armee, sind die übrigen hinsichtlich Kleidung und Bewaffnung bunt zusammengewürfelt. Gleichzeitig frech und scheu halten sie ihre Waffen, die Finger am Bügel. Typen in Trainingsanzügen und Latschen schleppen ihre Maschinengewehre an der Mündung hinter sich her. Einer von diesen, in einer Bundeswehruniform, den Helm lose auf dem Kopf, zielt nervös auf die Passanten. Die Szene wirkt surrealistisch. Der Brandgeruch ist bis hierher zum Flughafen zu riechen. Die etwa hundert Bewaffneten und ungefähr fünfhundert Flüchtlinge erinnern an ein Nomadenlager auf offenem Feld. Unser Wagen fliegt heran, ein typischer Kleinbus der Polizei. Wir springen von hinten in den vergitterten Affenkäfig. So fahren wir nach Osch, wo wir quasi hinter Gittern ankommen. Mit aus den Fenstern ragenden Gewehrläufen und voller Geschwindigkeit fahren wir an usbekischen Wohngebieten vorbei. Ich sehe die ersten Spuren und Anzeichen für das Ausmaß der Zerstörung. Ich begreife, dass dies nur der Anfang dessen sein würde, was uns erwartet. Wir verteilen Wasser an die Polizisten und stellen die ersten Fragen. Womit hat alles angefangen, was sich hier abgespielt hat. Sie erzählen uns eine erste Version, wer ihrer Meinung nach schuld ist. Wasser und Zigaretten, sie machten viele Menschen gesprächig, erwiesen sich auf unserer Reise als große Hilfe. Das beste Bakschisch im Krieg. Zwei Dosen Büchsenfleisch essen wir selbst, die erste Mahlzeit seit zwei Tagen. Kurze Zeit später wird klar, dass es trotz massenhaft herbeigerufener Soldaten noch nicht gelungen ist, die öffentliche Ordnung wieder herzustellen. Viele Menschen sitzen in ihren Häusern fest, Geiseln der gegenwärtigen Lage. Still sitzen sie in ihren Wohnungen in den fremden Wohngebieten. Die Nachbarn verraten sie nicht. Ich frage nach, wie viele dieser „Geiseln“ es gibt. Omurbek nennt eine Zahl von mehreren Hundert. Eine der dringendsten Aufgaben ist es, diese Menschen da raus zu holen. Wenig später sehen wir selbst solche, Kirgisen und Russen, die ihre usbekischen Nachbarn nicht an die Pogromisten ausgeliefert haben. Noch an Ort und Stelle bitten wir darum, einen Usbeken aus dem kirgisischen Viertel herauszuholen. Schon seit dem frühen Morgen bittet er meinen Freund Arkadij über das Handy um Hilfe. Omurbek, das muss man anerkennen, gibt sofort den Befehl, uns einen Wagen und eine Gruppe Specnaz1 bereitzustellen. Den Gesichtern der Soldaten ist anzusehen, dass ihnen die bevorstehende Operation nicht besonders gefällt. Wir steigen schnell ein und rasen los, durch Osch. Hier sind die Zerstörungen in ihrem vollen Ausmaß zu sehen. Eingeäscherte, verbarrikadierte Straßen, zerstörte Häuser. Der Brandgeruch wird schon zur Gewohnheit. Für viele Tage sollte er das einzige bleiben, was mein Geruchssinn wahrnahm. Ich vermag kaum zu glauben, was ich unterwegs zu Gesicht bekomme. Der Kommandant der Einheit erklärt, dass es schwierig sei, die Usbeken da rauszuholen, da die kirgisischen Anwohner solche Rettungsaktionen nicht gerne sähen und es möglich sei, von den Angehörigen der eigenen ethnischen Gruppe angegriffen zu werden. Ein weiteres Problem: Wem und wie sollen die Geretteten übergeben werden? Es gibt kein festes Verfahren, jeder Einzelfall ist eine riskante Improvisation. Unser Wagen fliegt durch das kirgisische Viertel. Die Soldaten schreien die Passanten an, damit sie uns durchlassen. Vor Schreck springen die Menschen zur Seite. Als wir das Haus gefunden haben, schwärmen wir aus, laufen, erwischen den falschen Eingang. Die Nachbarn schauen schockiert aus den Fenstern. Irgendeine ältere Frau nennt uns die Wohnungsnummer, ich wedle mit meinen Dokumenten herum, rufe, wir seien von der Presse und seien gekommen, jemanden zu retten. Wir stürzen in den Hauseingang. Die Soldaten stürmen ganz nach oben, während ich mit dem Hintermann zurückbleibe. Plötzlich öffnet sich im Erdgeschoss eine Tür. Automatisch richtet der Soldat sein Maschinengewehr in die Richtung und trifft dabei mit dem Lauf beinahe ein russisches Mütterchen ins Gesicht. Ehrlich erstaunt ruft diese aus: „Söhnchen, bist Du etwa gekommen, um mich zu töten?“ Erneut schreie ich, wir seien von der Presse, und beruhige die Alte. Oben hört man Getrampel und Schreie der Specnaz. Sofort schwant mir Übles und ich eile nach oben. In der aufgebrochenen Tür steht ein Mann, kreideweiß, und starrt auf die bewaffneten Männer. Mein Moskauer Partner sagt etwas zu ihm. Plötzlich werden Frauen aus der Wohnung herausgeführt! Das hatte gerade noch gefehlt. Ein Specnaz befiehlt ihnen, die Gesichter mit Tüchern zu umwickeln. Dann werden sie fortgeschafft. Als Letzte steht neben mir eine Frau. Sie versucht vergeblich, die Tür zu schließen. Sie lässt die Schlüssel fallen, versucht es nochmals, trifft erneut das Schlüsselloch nicht. Sie glaubt, dass man sie und ihre Familie abführt, um sie zu erschießen. Wir laufen ebenfalls nach draußen, rasen wie Besessene zum Wagen, die Menschen werden mit dem Gesicht nach unten hinein verfrachtet. Geschrei. Mit kreischenden Reifen fahren wir los. Nur kurze Zeit später stoßen wir auf eine kirgisische Straßensperre. Bewaffnete kommen auf uns zu. Der Kommandant der Spezialeinheit ruft ihnen etwas fröhlich-martialisches zu. Die Menge ruft fröhlich zurück, Stangen und Fäuste werden in die Luft gestreckt. Die gerettete Familie wird mit einer Plastikplane, welche man im Kleinbus gefunden hatte, zugedeckt, damit niemand den Kopf heben kann. Ich drehe mich um und sehe in das Gesicht eine kleinen Mädchens, bevor es unter der Plane verschwindet. Sie hat schon mit dem Leben abgeschlossen und schaut wie abwesend zum Himmel. Wir verlassen das kirgisische Viertel. Fünf Minuten später schießt der Adrenalinspiegel erneut in die Höhe. „Achtung! Bereit machen! Das usbekische Viertel!“, ruft der Kommandant der Sondereinheit. Erneut drohende Gewehrläufe, dann ein vollkommen ausgestorbenes Viertel. Keine Seele. Stille. Links ein zerstörtes Hochhaus. „Vielleicht Sniper. Beobachten! Bei der kleinsten Bewegung sofort scharf schießen!“ Gleich wird die Übergabe der Familie an die usbekische Seite erfolgen. Wir halten an und hocken uns hinter den Wagen. Das Gebäude beunruhigt uns. Die Familie wird an der Wand aufgereiht. Die Atmosphäre wird immer angespannter. Arkadij schlägt vor, als Journalist vorzutreten und die Menschen offen an die Usbeken zu übergeben. Einer der Soldaten sagt, dass sie dann sofort die ganze Gruppe erledigen würden. Der Kommandant steht auf und geht um die Ecke des Gebäudes, an welches wir uns geschmiegt hatten. Ich höre, wie er befiehlt, die Familie zu erschießen, sollten sie ihn umbringen. Die Familienmitglieder stehen mehr tot als lebendig an der Wand, als sei ihnen alles schon egal. Dann ertönt das Kommando „Freilassen!“ und gleichzeitig Bewegung im Gebäude gegenüber. Ein Mann läuft los. Niemand eröffnet das Feuer. Die Einheit und wir springen in den Kleinbus und mit Geschrei und Waffengeklirr rasen wir davon. Nach etwa fünf Minuten rühren sich die ersten, einige fangen an zu reden, es wird geraucht, Wasser getrunken. Die Operation ist beendet. Telefonisch erstattet der Kommandant Bericht. Der Stress lässt nach. Später erzählt der Usbeke, der seit dem frühen Morgen angerufen und die Geretteten in Empfang genommen hat, dass er um die Ecke 20-25 Dollar für die Befreiung der Familie bezahlt habe … Die Befreiung von Geiseln aus der Perspektive journalistischer Ethik verstand übrigens jeder auf seine Weise. Wir waren Zeugen, wie ein amerikanischer Journalist gebeten wurde, ein paar Kinder aus einem kirgisischen Viertel raus zu holen. Er sagte zu. Ein Usbeke, der Amerikaner und ein Dolmetscher fuhren in das Viertel, zeigten die Ausweise mit der Aufschrift „Presse“, luden die Kinder vor den Augen der verdutzten Kirgisen in ihren Wagen und fuhren ihnen unter der Nase davon. Es war offensichtlich, dass selbst der Amerikaner nicht erwartet hatte, dass sich die Ereignisse so abspielen würden. Das heißt, im Grunde hatte vor allem der Usbeke sehr klug und präzise gehandelt. Meiner Meinung nach verstand der Amerikaner nicht ganz, was geschah, und erkannte nicht sofort, dass er als menschlicher Schutzschild verwendet wurde. Später, als er schon mit uns im Auto saß, klagte er darüber, dass er die journalistische Ethik verletzt habe. Er sei nicht neutral gewesen, sondern habe sich, indem er an der Rettung der Kinder teilgenommen habe, auf eine Seite gestellt, was man trotz allem vermeiden sollte. Derselbe Journalist wollte unbedingt eine Beerdigung filmen. Er bat die Usbeken, ihn für eine Aufnahmesession anzurufen, sobald sie wieder eine Leiche finden würden, die bestattet werden musste. Dieser besondere Wunsch schien ihm in keiner Weise unethisch zu sein. Wir gehen zu Fuß los zur usbekischen Machalla. Wir bringen Zigaretten, Wasser, Dosenfleisch und Gerstengrütze mit. Unser Ziel ist der Mann, der mehrmals anrief und bat, die Familie seines Nachbarn zu retten. Wir sind neugierig, um was für eine Familie es sich gehandelt hatte, und überhaupt wollen wir die andere Seite sehen. Es ist unser erster selbstständiger Gang durch die Stadt. Ohne Waffen. Aufmerksam beobachten wir die Zerstörungen, die Aufschriften oder Schilder „Kirgise“ an den Türen der Verkaufsstände und Läden, welche diese vor Plünderung bewahrten, zahlreiche andere unverständliche Aufschriften, das Hin und Her finsterer, mit Maschinengewehr bewaffneter Gestalten, die vorbeifahrenden Autos mit bewaffneten Zivilisten an Bord, die Barrikaden. Die Barrikaden lassen mich immer wieder erstarren. Sie sind einfach riesig: Container, riesige Steinblöcke, Schienen, Trägerplatten aus Beton, umgekippte Anhänger, Busse und Milchwagen. Wie war es möglich, dies alles in so kurzer Zeit heranzuschaffen und aufzustellen? Dazu mit bloßen Händen! Es sind nur wenig Menschen unterwegs. Einige wenige Hunde streunen ohne zu bellen umher. Die Hunde wenden den Blick ab, genau wie unbewaffnete Menschen. Behutsam und vorsichtig laufen sie niedergeschlagen umher. Im Irak sind die Hunde anders, aggressiver. Sie haben sich daran gewöhnt. Diese hier offenbar noch nicht. Sie haben so etwas von den Menschen nicht erwartet. Wir gelangen zum usbekischen Viertel, jede Sekunde in Erwartung einer Kugel aus dem Nirgendwo. Wir stellen uns vor, verteilen Lebensmittel, Tabak. Dann werden wir durch die Machalla geführt. Zum ersten Mal im Leben habe ich vollständig zerstörte Wohnungen gesehen. Wenn wir bisher von der Straße nur die Fassaden der Häuser gesehen hatten, konnten wir nun ins Innere des Viertels eindringen. Es gibt keinen heilen Ort. Alles ist verbogen, verbrannt, verwüstet. Es ist schwierig, sich vorzustellen, wie man dies ohne den Einsatz schweren Geräts verwirklichen kann. In der verkohlten Leo-Tolstoi-Schule liegen Schulbänke herum. In der Brandruine sehe ich Hefte, Notizen, Kärtchen. Ich hocke mich hin und blättere darin. Das Krankenhaus zu betreten, kann ich mich hingegen nicht entschließen. Der ebenfalls verbrannte sowjetische Getränkeautomat der Marke „Gazvody“ gleicht einem Symbol der für viele hier für immer begrabenen Kindheit. Wir irren über die Brandstätte. Überall sind Einschusslöcher zu sehen, von Gewehrkugeln und auch von größeren Geschossen. In den Kellern und unter den Trümmern liegen vielleicht noch weitere Leichen. Der amerikanische Journalist berichtet uns einen Tag später, dass er in einem Haus ein verbranntes Skelett gefunden habe, das noch nicht weggeräumt worden sei. Einige gesunde erwachsene Männer begleiten uns, erzählen uns weinend, was passiert ist. Frauen und Kinder haben sie alle evakuiert. Über der Stadt kreist ein Helikopter. Er wirft Flugblätter ab, die zum Frieden aufrufen, aber die Menschen weichen furchtsam zurück, drücken sich an die Hauswände. Wir gehen zum Friedhof. Man zeigt uns die frischen Gräber, ungefähr zwanzig bis dreißig. Der Totengräber weint. Solche Friedhöfe gibt es in jeder Machalla, insgesamt wohl mehr als zehn in ganz Osch. In den usbekischen Vierteln trifft man auch auf russische Staatsangehörige. Im Grunde genommen sind es eher ethnische Usbeken mit einem Pass der Russischen Föderation. Aber ich begegne auch solchen, die unglücklicherweise aus Russland hergefahren sind, um Verwandte zu besuchen, und die sich nun plötzlich in der Hölle wiederfanden. Nikolaj aus Ekaterinburg zeigt mir sein Flugticket, sein einziges Dokument. Er kam einen Tag vor dem Ausbruch der Gewalt in Osch an und weiß nicht, was er nun tun soll. Er fürchtet sich, nach draußen zu gehen. Insgesamt werden Russen in Ruhe gelassen. Vielleicht ist dies eine Chance für einheimische Russen, in den Verhandlungen zwischen Kirgisen und Usbeken zu vermitteln. Die Usbeken schließen eine solche Möglichkeit jedenfalls nicht aus. Es ist zumindest eine Möglichkeit, einen Ausweg aus dem Patt zu finden. Interessanterweise ist es die Jugend, die in den Machallas am aktivsten ist. Sie lebt, versucht, voran zu kommen, schmiedet Zukunftspläne, spricht mit den Journalisten und führt sie, unter Einsatz des eigenen Lebens, durch die Siedlungen. Es sind selbstlose Individuen, die Anerkennung hervorrufen. Sie organisieren die Rettung von Kindern mit der Hilfe von Reportern aus der ganzen Welt, obwohl letztere darüber murren, so etwas tun zu müssen, weil sie dadurch in eine für ihren Beruf ambivalente Situation zu geraten. Solange sich die Jugend bemüht, gibt es eine Chance, dass das Leben weitergeht, gibt es wenigstens bei einigen noch ein Fünkchen Hoffnung. Die Erwachsenen und die Generation der Alten befinden sich in einem Zustand völliger Erschöpfung. Wie Gespenster wandeln sie durch ihr Viertel. Auf usbekischer Seite gibt es bisher weder Verhandlungsorgane noch Wortführer, Selbstverwaltung oder Führungspersönlichkeiten. Alle stehen noch unter Schock. Gleichzeitig werden die eingeschlossenen Menschen langsam wahnsinnig. Es gehen Gerüchte um, die Journalisten seien Spione, die für die kirgisische Seite die Situation auskundschaften. Einem anderen Gerücht zufolge sollen die Jungen an den Journalisten Geld verdienen. Menschen mit kirgisischen Ehegatten oder Verwandten werden plötzlich angefeindet. Anstand und Sitten der Menschen verfallen, sie beginnen, sich gegenseitig zu beschuldigen, sich zu entzweien. Nach usbekischen Angaben kann weder von einem spontanen noch von einem von außen provozierten Ausbruch der Gewalt die Rede sein. Ihrer Meinung nach handelte es sich um eine geplant durchgeführte Operation. Einige Tage vor den Pogromen wurde die Sperrstunde eingeführt, jedoch nur für Usbeken, das heißt, diese wurden ihrer Bewegungsfreiheit beraubt. Kurz nach dem Morgengebet drangen gepanzerte Fahrzeuge in die Machallas ein, ihnen folgten Uniformierte, und in einer dritten Welle kamen Marodeure und Pogromisten mit improvisierten Flammenwerfern, eine Masse aus tausend Personen. Der Angriff dauerte zwei, drei Stunden, dann zogen sich die Parteien zurück, ruhten aus, und dann begann alles von neuem. So ging es den ganzen Tag. Es wurden auch Scharfschützen eingesetzt. Zumindest sind auf den Videoaufnahmen des improvisierten Krankenhauses gezielte Schüsse in den Kopf oder ins Herz zu sehen. Auf usbekischer Seite habe ich keine Waffen gesehen, weder in den Häusern noch in den Stadtvierteln. Ich fand einen geöffneten Safe. Daneben lagen persönliche Dokumente, die ich aufhob und an Anwohner übergab. Später sah ich, wie alte Männer die gefundenen Dokumente aufmerksam durchlasen. Von den Marodeuren wurde wenig gesprochen, es gab ausschließlich schreckliche Geschichten von Folter und Tod. Wir fragten viele, wie und womit alles angefangen habe. Über die Ursachen konnte kaum jemand etwas Klares berichten, außer allgemeinen Phrasen über Nomaden und Ackerbauern, über Wasser und Land, über die Frage, wem dieses Land historisch zustehe, wer klüger und wer dümmer sei. Alles aus dem Bereich der Theoriebildung. So kurz nach den Ereignissen sprach man mehr über die Anlässe. Jede Seite hatte ihre Schauermärchen, wer zuerst und wie über wen hergefallen sei. Die Sicherheitsorgane sprechen eher von der „neutralen“ Bakijew-Spur, auch die Drogen-Version schließen sie nicht aus. Aber über handfeste Beweise verfügen auch sie nicht. Die Einheimischen glauben keine dieser Versionen. Sie beschuldigen in erster Linie den Nationalismus der anderen. Aber wie auch immer es tatsächlich gewesen sein mag, der Anlass ist nunmehr unwichtig, da sich das Ganze zu einem nationalen Gemetzel von ungekannter Verbitterung ausgeweitet hat. Über Jahre oder sogar Generationen werden sie versuchen, das Zusammenleben wieder zu normalisieren – oder sie werden sich endgültig von einander abspalten. Als wir die Machalla verlassen, ist die Sperrstunde bereits angebrochen. Wir sind schmutzig, mit Ruß bedeckt, bestürzt über das, was wir gesehen haben. Es ist sehr unangenehm, durch die leere Stadt zu gehen. Die einzigen Geräusche sind das Rascheln der Patronenhülsen unter unseren Füßen und die Schüsse, die von Zeit zu Zeit irgendwo zu hören sind. Dabei gehen wir einzeln. Irgendwie scheint es in dieser Situation besser, einzeln zu gehen, warum, weiß ich nicht. Als wir an eine Kreuzung kommen, verliere ich vollends die Fassung. Über die verkohlte und qualmende Straße geht ein junges Paar mit einem Kinderwagen, in dem der Kopf eines Kleinkindes zu sehen ist. Nach den Schrecken der vergangenen vierundzwanzig Stunden scheint dieser Anblick unwirklich, fantastisch, wie von einem anderen Planeten. Am nächsten Tag versuchen wir, nach Dschalalabat zu kommen, um Miroslav Nijazov und seine Hundertschaft von Freiwilligen aus Bischkek zu interviewen. Die Sicherheitsorgane können uns keinen Wagen zur Verfügung stellen, und Usbeken wie Kirgisen weigern sich strikt, durch die Siedlungen der ehemaligen Nachbarn zu fahren. Schließlich fahren wir an die Grenze zu Usbekistan. Die Grenze ist schon verschlossen, das heißt, genau genommen bewachen Wachmänner das Loch im Grenzzaun, welcher die Funktion des Kontrollpunktes ausübt. Es werden nur Schwerverletzte durchgelassen. Rundherum nur Kinder und Frauen. Geschrei. Hass gibt es hier viel, Hilfsgüter dagegen wenig. Nur unter großen Anstrengungen gelingt es uns, den Ort zu verlassen. Die Menschen wollen uns nicht durchlassen. Jeder will seine persönliche Geschichte, die Tragödie seiner Familie erzählen. Wir fahren in das Dorf Narinam, um etwas über unseren getöteten Reisebegleiter zu erfahren. Doch es gibt keine Informationen. Irgendwann scheint mir, dass der Zorn und die Emotionen der Menschen außer Kontrolle geraten. Da wir nichts in Erfahrung bringen können, fahren wir weiter. Bei der Ausfahrt eines usbekischen Dorfes fällt mir an einer Straßensperre ein einfacher, wohl um die hundert Jahre alter Greis auf. In der Hand hält er einen gewöhnlichen Ast, an dessen Ende ein langes scharfes Messer befestigt ist. Das Messer ist frisch geschliffen und blinkt in der Sonne. Der Alte sitzt auf einem kleinen Hügel, sein Stab mit dem Messer befindet sich genau auf Augenhöhe der den Posten passierenden Autofahrer. Der Alte sitzt da wie aus Stein gemeißelt, wie ein Denkmal und ewiger Zeuge der Zwietracht. Sein Anblick fesselt mich irgendwie, ein Bild, das ich nie vergessen werde. Die Straßensperren, ob in der Stadt oder auf den umliegenden Straßen, sind ein eigenes Kapitel. Ist irgendwelches Kriegsgerät vorhanden, ist es noch erträglich, scheint doch wenigstens ein Ansatz von Ordnungsmacht, Armee oder Polizei vorhanden zu sein. Gefährlicher sind die improvisierten Straßensperren zwielichtiger Personen. Wer sind sie? Was wollen sie? Mit welchem Recht? Ihr Anblick ist unangenehm und bedrohlich. Alte Männer mit roten Gesichtern und undurchdringlichem, gleichgültigem Blick. Und noch schlimmer sind die Straßensperren junger, aggressiver Männer, die sofort mit Gewehrläufen auf einen zeigen und einem befehlen, das Auto zu verlassen. In Shorts und mit vermummten Gesichtern überprüfen sie die Papiere, nörgeln an jeder Zahl, an jedem Schriftzug herum. Usbeken ohne Ausweis werden irgendwo hingebracht. Von diesen Straßensperren aus kommt es auch zu Zusammenstößen mit den Wachen der Barrikaden. Aber die Posten in der Stadt beeindrucken durch eine andere Besonderheit. Sie krempeln die Hosen hoch, anstelle der Stiefel tragen sie Badeschlappen, neben ihren gepanzerten Fahrzeugen stellen sie Stühle und Sessel auf und sitzen mit Teekochern und Thermosflaschen in T-Shirts oder mit bloßem Oberkörper herum, das Maschinengewehr im Schoß. Viele tragen schwarze Sonnenbrillen. Sie sehen aus wie Rambo. Auf den Panzerfahrzeugen ausgebreitet liegen kostbare Teppiche. Vor unseren Augen beschuldigen sie einen festgehaltenen Passanten, ein Sniper zu sein, weil er eine Handvoll Baumunition und ungefähr 5000 Rubel in örtlicher Währung bei sich trägt. Für uns werden Videomaterial, Handyaufnahmen, Aussagen von Verletzten, Bilder aus den Leichenhallen gesammelt. Aber man glaubt nicht, dass wir diese Information nach draußen bringen können. Gerüchten zufolge seien an einer Straßensperre sämtliche Disketten französischer Journalisten konfisziert worden. Einige Aufnahmen sehe ich mir gleich in dem Haus auf dem einzigen Rechner des Viertels an. Es sind die Bilder aus der Leichenhalle. Als man mir Fotos der Leichen verkrüppelter alter Frauen zeigt, verlasse ich das Haus und setzte mich auf die Eingangstreppe. Zum ersten Mal lässt man mich in Ruhe, sammelt sich um mich herum keine Menge an. Ein paar Minuten sitze ich schweigend dort, bevor ich wieder aufstehen und weitergehen muss. Auf dem Heimweg sehe ich plötzlich etwas auf der Straße. Ich sehe genauer hin und erkenne eine Schildkröte, die die Fahrbahn überquert, die langsam und hartnäckig auf das rettende Gras am Straßenrand zukriecht. Ich weiß nicht, warum, aber ich gehe auf sie zu und beginne, sie zu fotografieren. Die Schildkröte blinzelt noch nicht einmal. Nach zwei Tagen der Zerstörung, des Kummers, weinender Frauen und verbitterter Männer, ausgebrannter Gebäude, der Barrikaden, der Waffen, der Bilder von Getöteten, scheint mir diese Schildkröte wie das einzige Geschöpf Gottes auf dieser Welt. Ich sehe ihr ins Gesicht und verstehe, dass sie wunderbar ist. Ein wunderbares Geschöpf. Sie kriecht auf ihr Ziel zu, ohne sich um den Krieg und die menschlichen Zerstörungen zu kümmern. Vielleicht können dereinst auf dieser Erde auch zwei Völker mit ebensolcher Hartnäckigkeit und Ruhe gegenüber inneren und äußeren Störenfrieden zur Aussöhnung finden. Ein älterer Kirgise fährt uns mit seinem Auto zum Flughafen. Nach jeder Straßensperre verflucht er die kontrollierenden Beamten und jüngsten Geschehnisse. Wie viele andere Gesprächspartner hofft auch er, dass wir nochmals nach Osch kommen, wenn irgendwann wieder gute Zeiten anbrechen. Dank dem Flughafenkommandanten sind wir weniger als eine Stunde später schon in der Luft. Während das Flugzeug aufsteigt, sind im Hintergrund Rauchsäulen zu sehen. Unter uns gehen Angst und Hass, Hoffnung und Enttäuschung weiter, es wird geschossen, Menschen leiden. Wir überfliegen einen Bergkamm. An den Abhängen liegen Schneestreifen. Das Ganze erinnert an ein riesiges, bis zum Horizont über die Erde ausgebreitetes menschliches Skelett. Und nochmals eine Stunde später, nachdem wir den Flughafen verlassen haben, höre ich, wie auf dem Bildschirm eines Cafés eine muntere Sprecherin des lokalen Nachrichtenprogramms verkündet, dass in Osch schon wieder Ruhe eingekehrt sei und Frauen und Kinder mit Blumensträußen in den Händen durch die Stadt spazierten … 25. 06. Morgens bin ich erneut an Bord gegangen, zur nächsten Reise. Nicht nach Kirgisien, sondern zu den Schauplätzen eines anderen ethnischen Konfliktes. Dort wird schon nicht mehr geschossen. Ich werde zwischen Ruinen umherstreifen. Wie mir der örtliche Stalker2 mitteilte, gibt es dort einen bestimmten Felsen. Rechts davon liegt die tote, vom Krieg zerstörte Stadt, links die Stadt jener, welche dem Krieg entkommen sind, die Stadt der Lebenden, lichtdurchflutete Straßen, menschliches Lachen. Der Stalker sagte, er habe schon einen kleinen Hain ausgesucht, wo ich mich hinsetzen, Wein trinken und beide Städte überblicken werden könne. So sieht der Wiederaufbau aus. Und nachts geht der eine in die Stadt der Toten, der andere in die Stadt der Lebenden. Der Reihe nach. Bis dann. Aus dem Russischen von Tadzio Schilling.
01.01.2011
Empfohlene Artikel
|
|||||||||||||
|
04.02.2020 10:17
Letošní 50. ročník Art Basel přilákal celkem 93 000 návštěvníků a sběratelů z 80 zemí světa. 290 prémiových galerií představilo umělecká díla od počátku 20. století až po současnost. Hlavní sektor přehlídky, tradičně v prvním patře výstavního prostoru, představil 232 předních galerií z celého světa nabízející umění nejvyšší kvality. Veletrh ukázal vzestupný trend prodeje prostřednictvím galerií jak soukromým sbírkám, tak i institucím. Kromě hlavního veletrhu stály za návštěvu i ty přidružené: Volta, Liste a Photo Basel, k tomu doprovodné programy a výstavy v místních institucích, které kvalitou daleko přesahují hranice města tj. Kunsthalle Basel, Kunstmuseum, Tinguely muzeum nebo Fondation Beyeler.
|









































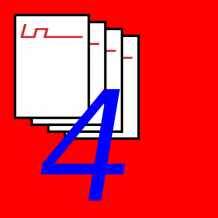
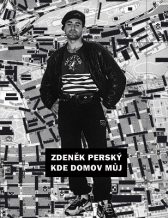


 Potsdamer Str. 161 | Neu Divus in Zwitschermaschine, galerie und buchhandlug in Berlin! | Mit U2 nach Bülowstraße
Potsdamer Str. 161 | Neu Divus in Zwitschermaschine, galerie und buchhandlug in Berlin! | Mit U2 nach Bülowstraße
Kommentar
Der Artikel ist bisher nicht kommentiert wordenNeuen Kommentar einfügen